Vorwort
Ich lese ich gerne Vor-/Nachworte und Einleitungen. Oft tragen sie zum Inhalt oder Verständnis bei. In einem dieser Vorworte ist mir auch Bakers „Wanderfalke“ begegnet. Das Buch wurde als die maßgebliche Referenz für das moderne Nature Writing angegeben. Die Einleitung von Robert Macfarlane geht in eine ähnliche Richtung und ich erwarte nichts weniger als den Thoreau des 20. Jahrhunderts in Händen zu halten. Andererseits wird betont, wie wenig – also eher gar nichts – der Leser über J.A.Baker erfährt. Und ich denke spontan, dass dies doch der Kernbestandteil von Nature Writing ist: Die Beziehung des Autors zur Natur um ihn herum. Wie soll das gehen, wenn der Autor für mich als Leser völlig unbekannt bleibt?
„Wenn man dem Buch so etwas Konventionelles wie eine Handlung zuschreiben möchte …“ Hm, das wird ein ungewöhnliches Buch: (1) Man weiß nichts über den Autor und (2) es hat keine Handlung. Robert Macfarlane beschreibt das Buch als „Elegie für einen Ort“. Ich dachte, es ginge um Wanderfalken…
Vieles im Vorwort, wie die Verweise auf „Warten auf Godot“, Anaximander von Milet oder die Sonette Rainer Maria Rilkes, stammen aus dem Wissen von Robert Macfarlane. Hat Baker dies alles wirklich beim Schreiben bedacht oder ist es nur die Interpretation des universitär geschulten Rezensenten? Entdeckt Robert Macfarlane möglicherweise Dinge, die der Autor gar nicht wusste?
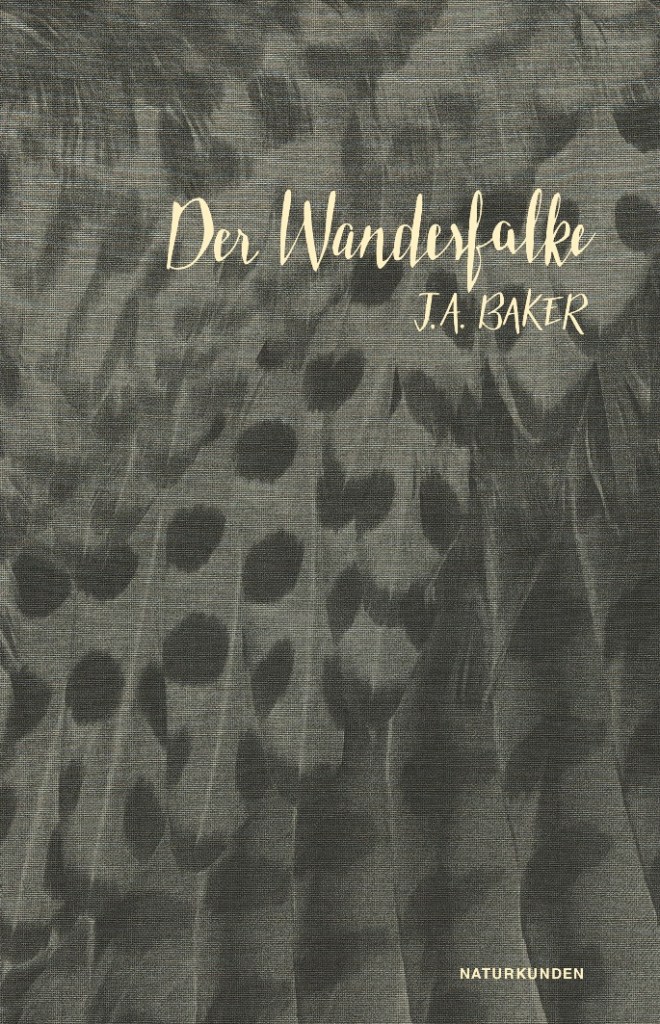
Anfänge & Wanderfalken
Das Buch ist in zwei kurze sachliche und ein langes Hauptkapitel eingeteilt. Das erste berichtet, wie Baker die Wanderfalken für sich entdeckte.
Baker berichtet über Vögel, die er bisher beobachtet hatte (Nachtschwalben, Sperber) und dann sieht er den ersten Wanderfalken. Aufgrund dieses Erlebnisses beschließt er, Wanderfalken intensiv zu beobachten. Es folgen genaue Anleitungen, wie man einen Wanderfalken beobachten muss. Angefangen von der immergleichen Kleidung über den Schimmer der eigenen Augen bis zum Verbergen des Menschseins.
Das zweite Kapitel „Wanderfalken“ ist ein kurzes Lehrbuch der Vogelkunde mit vielen Fakten und Zahlen. Überraschend innerhalb dieses Sachkapitels finde ich die Aussage, dass Wanderfalken keinen anspruchsvollen Gaumen haben. Wie findet Baker heraus, ob die einzelnen Beutetiere für den Wanderfalken einen unterschiedlichen Geschmack haben? Haben Vögel generell einen ausgeprägten Geschmackssinn? Und wenn ja, was schmecken sie?
Leben und Jagen
Nach 40 Seiten Einführung beginnt das eigentliche Buch. Ich bin gespannt und freue mich darauf, dieses so hochgelobte Buch endlich selbst zu lesen.
Gleich auf den ersten Seiten finde ich mich in einer umfassenden Ansammlung von Adjektiven wieder und Baker beobachtet Dinge, die er gar nicht sehen kann. Hat Baker übermenschliche Fähigkeiten, dass er die „glänzendbraunen Hundeaugen“ eines Wanderfalken, der sich „durch die dunstigen Luftschichten in die Sonnenwärme hinaufarbeitet“ sehen kann? Oder ist dies das Geraune von dem Ludwig Fischer bei seiner Beschreibung von schlechtem Nature Writing spricht? Und wieso Hundeaugen? Sind die Augen des Wanderfalkens genauso groß oder treuherzig wie die eines Hundes? Alles das widerspricht vollständig dem, was Baker in der Einleitung sehr deutlich formuliert: „Der Wanderfalke fliegt in einer solchen Höhe, dass er für das menschliche Auge vom Boden aus nicht sichtbar ist“. Dennoch hält dieses Wissen Baker nicht davon ab, jedes Detail des fliegenden Vogels so zu beschreiben, als läge er unter einem Mikroskop.
Zumindest ist es eine stufenlose Vermischung aus theoretischem Wissen über das detaillierte Aussehen des Vogels und der praktischen Beobachtung eines Flügelschlags am Himmel. „Wenn dies ein Wanderfalke ist, dann hat er eine rotbraune Maserung und braune Augen.“ Das wäre die Beobachtung.
Die schrill rufenden Schwalben. Das gemähte Korn. Dies alles sind gelungene Beschreibungen eines Herbsttages. Doch sobald jedoch der Wanderfalke ins Bild kommt, wird es Fantasie. Baker füllt den Text mit vollmundigen Beschreibungen von ockergelbsandfarben über froschähnlich bis hin zur Zitrone im Maul eines gebratenen Ebers. Ich lese jeden Satz zwei Mal, bis ich das eigentliche Gerüst des Satzes gefunden habe, und die zahllosen Beschreibungen an den rechten Platz rücken kann.
Die massive Überadjektivierung macht das Lesen mühsam. Wenn in jedem Satz drei Adjektive stecken, dann muss man sich entweder ständig wiederholen oder immer ausgefallenere Wörter finden. Baker entscheidet sich für letzteres. Da wird das Helldunkel des Himmels zusätzlich auch hinreißend. Da sehen Schnäbel aus wie Gesteinsstifte, Wanderfalken kleiden sich in heraldisches Schwarz und der Falke steigt mit lyrischer Leichtigkeit auf tausend Fuß und höher. Auch sich widersprechende Beschreibungen innerhalb eines Satzes sind kein Hindernis: Klirrende Stieglitze verstecken sich stumm.
Ich verstehe nun, den Hinweis aus dem Vorwort, dass der Leser keine Handlung erwarten darf. Aber um was geht es dann in diesem Text? Robert Macfarlane beschreibt den Text als Elegie für einen Ort, also ein trauriges, klagendes Gedicht. Einige Seiten weiter liegt der Nebel als „schwüler Dunst, der mit kalten Fingern ins Gesicht fasst, stinkend im Straßenrand, wie ein Dinosaurier im Sumpf“. Das ist wirklich eine traurige Landschaft.
Ich werde den Wanderfalken nicht zu Ende lesen. Zu mühsam ist der in jedem Satz angehäufte Berg aus Adjektiven. Baker mischt nach Herzenslust eigene Wahrnehmung mit Sachbuchwissen. Die Übergänge sind so fließend, dass es unmöglich ist, zu erkennen, was er nun tatsächlich erlebt hat, und was Ergänzungen aus der Fachliteratur sind.