Sobald ich eine neue Internet-Seite oder einen vielversprechenden Blog über Nature Writing entdecke, gibt es dort weitere „Klassiker“, von denen ich noch nie gehört habe und viele, der mir bisher bekannten Autoren sind wiederum dort mit keinem Wort erwähnenswert. Mit dem Stichwort Klassiker bin ich daher vorsichtig geworden. Für jede Facette der Naturliteratur und jeden Experten gibt es jeweils eigene Klassiker. Das Stichwort Klassiker taugt also nur wenig, um sich einen Weg durch die Literatur zu suchen. Ich habe zwei Strategien, die mich dabei leiten:
1 Ich ordne die Autoren nach dem Erscheinungsjahr ihrer Werke.
Es hilft mir, Texte nebeneinander zu stellen, die in einer ähnlichen Zeit entstanden sind. „Yosemite“ und „Wo wenig Regen fällt“ sind ein gutes Beispiel. John Muir und Mary Hunter Austin schreiben zur fast gleichen Zeit sehr unterschiedlich über die Landschaft, die sie erleben. Dieser direkte Vergleich macht das Besondere eines Textes für mich oft sehr deutlich.
2 Ich achte darauf, welche Bücher und Personen ein Autor oder auch ein Rezensent in seinem Text erwähnt.
Mittlerweile wurde „Der Wanderfalke“ von J.A. Baker so oft erwähnt, dass ich dieses Buch kennenlernen möchte. Dieses Entlanghangeln von Buch zu Buch führt mich immer wieder zu neuen Schätzen. Gelegentlich ist es allerdings auch eine Enttäuschung und ich habe den Eindruck, dass eine Buchvorstellung von der anderen abschreibt.
Nan Sheperd „Der lebende Berg“ (The living mountain, UK 1977)
„Die ureigene Natur dieser Landschaft zu erkennen, das ist es, worum es mir hier geht. Dies geschieht nicht spielend leicht, noch in einer Stunde. Es handelt sich um eine Erzählung, die zu langsam für die Ungeduld unseres Zeitalters ist, in ihrer Bedeutung nicht unmittelbar genug für seine dringenden Probleme.“
So setzt sie an mit ihrem Text. Nicht das Göttliche der Philosophen oder das Innerste des Regenwurms, nein, einfach nur das ureigene Wesen der Landschaft um sie herum, das ist es, was sie verstehen und beschreiben will. Ein bescheidener Ansatz. Ein Ansatz, der mich mit voller Wucht trifft. Ein Text, in dem es um die Wirklichkeit jener Dinge geht, die letztlich zählen im Leben. Kein pingeliges Aufzählen jedes einzelnen Steinchens, aber das ureigene Wesen der Landschaft, deren Teil sie als Schreibende ist und deren Teil ich als Leser werde.

Nan Shepherd schreibt in langen verschlungenen Sätzen. Sätze, die wunderschön klingen, wenn Tilda Swinton sie in der englischen Version des Hörbuchs vorliest.
In diesen verschlungenen Sätzen blickt sie hinter die Dinge. Auf den ersten Blick ist ein See einfach nur ein See. Doch Nan Shepherd macht deutlich, wie viel mehr zu einem See gehört. Der gesammelte Regen des Hochplateaus, der in zahllosen Bächen die verschiedenen Lochs mit schier unnatürlich klarem Wasser füllt. Die Wolken, die sich auf der Oberfläche spiegeln. Die entlegene Stille, die den Bergsee von einem See im Tal unterscheidet. Alles das macht ihn zu dem Ort, der er ist.
Ein Ort, der verschwinden wird, wenn erst Touristenströme mit Geländewagen und Fastfoodeinwegverpackungen über ihn herfallen. Auch wenn es das gleiche Wasser, die gleichen Steine bleiben werden.
Viele Jahre Lebenserfahrung und endlose Kilometer an Wanderungen stecken in diesem schmalen Band.
Das Buch enthält Nan Shepherds Berggedanken. Etwa 30 Jahre, ein Vierteljahrhundert lang lag das Manuskript in der Schublade und ist doch bei der Veröffentlichung 1970 so aktuell wie 1940. Ja, es ist auch 2020 immer noch aktuell, was Nan Shepherd formuliert hat.
„Hier also könnte man ein Leben der Sinne leben … so unberührt von jeder anderen Art der Erkenntnis, dass man sagen könnte, der Körper denke.“
Ist es das, was mich so aufatmen lässt, wenn ich die Büroarbeit in der „lebendigen“ Stadt hinter mir lasse und in der „kargen“ Natur ankomme? Selbst die auf den ersten Blick steinige und leblose Natur des immer wieder neu beschriebenen Hochplateaus der Cairngorms bietet mehr Eindrücke für die Sinne als jede quirlige Stadt.

Mary Hunter Austin „Wo wenig Regen fällt“ (Land of little rain, USA 1903)
Mary Hunter Austin veröffentlichte 1903 vierzehn kurze Geschichten über Landschaft, Tiere und Menschen der Mojave-Wüste im Südwesten der USA. Sie hatte diese Region viele Jahre lang durchstreift und dann in nur wenigen Wochen die Texte für das Buch „Land of little rain“ geschrieben.
Schon das Vorwort ist schon eine eigene Geschichte. Es ist kein Vorwort eines Herausgebers oder sonstwie schlauen Menschen, es ist das Geleitwort der Autorin, die deutlich macht, wie sie ihr Schreiben versteht. Ich finde so etwa immer hilfreich. Vielleicht auch, weil ich es vom Technical Writing gewöhnt bin. Da ist es ganz selbstverständlich einem Text eine Art Gebrauchsanleitung in Form eines „Dieser Text ist gut für“ voranzustellen.
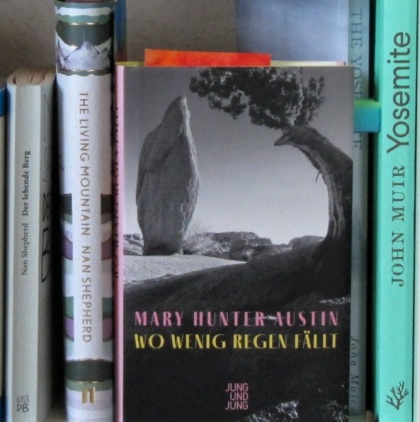
Sofort wird klar, hier schreibt jemand, der mit und in dieser Landschaft lebt. Kein Zaungast oder Durchreisender. Um so zu schreiben braucht es viele Jahre des eigenen Erlebens und die Bereitschaft sich auf Natur und Menschen einzulassen. Gleichzeitig sind gerade auch die Naturbeschreibungen teilweise die schwierigeren Texte. Die Sätze sind lang und verschlungen und gelegentlich bleibt unklar, von was sie eigentlich redet. Weil sie unbekannte Pflanzennamen einstreut oder bei einzelnen Worten gar nicht klar ist, ist das eine Pflanze, ein Mensch oder ein Ort. Und dann wieder Texte wie „Die Korbflechterin“, ein Text so wuchtig und dabei schlicht wie ein wummernder Kohleherd in der Küche.
Emily Carr „Klee Wyck – Die, die lacht“ (Klee Wyck, CAN 1941)
Emily Carr war eine kanadische Malerin. Sie lebte von 1871 bis 1945. In ihrem Buch „Klee Wyck“ beschreibt sie zahlreiche Besuche in bewohnten oder auch bereits verlassenen Dörfern der First Nations an der kanadischen Westküste. Das „offizielle“ Thema des Buches sind Emily Carrs Gemälde der Totempfähle und die Begegnungen mit den Angehörigen der First Nations. Doch in den Texten steckt so viel Naturbeschreibung, dass „Nature Writing aus British Kolumbien“ den Inhalt ebensogut trifft.
In den 21 Texten des Buches beschreibt sie einzelne Dörfer oder auch Personen. Es ist beeindruckend zu sehen, mit wie einfachen Mitteln Emily Carr ein Bild entstehen lässt. Jeder zweite, dritte Satz lässt sich anstreichen, weil er in knappen aber nie kargen Worten einen ganzen Absatz an Gefühls- und Landschaftsbeschreibung zusammenfasst. Keine Heldenreise. Kein konfliktbeladener Spannungsbogen. Stattdessen wenige Worte und klare Sätze, die ein plastisches Bild der Landschaft oder eines Dorfes erscheinen lassen.
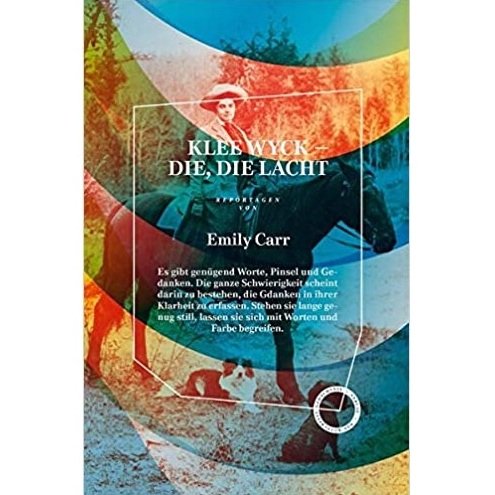
Emily Carr schreibt dabei sehr neutral. Die Bilder entstehen beim Lesen erst in meinem Kopf. Der deutliche Grusel davor, das Missionshaus auch nur zu betreten und den im Gegensatz dazu freundlichen Blick auf das benachbarte Dorf der First Nations. Schon bevor ich als Leser das erste Mal dort ankomme, habe ich den Eindruck, es zu kennen. Und das ordentliche Leben der Missionarinnen wirkt viel trostloser als die schmutzige Armut der Ureinwohner.
Carrs Stärke ist die gemeinsame Betrachtung von Mensch und Natur. Mensch- und Naturbeschreibung ergänzen einander. Von beiden Seiten erfährt man auch etwas über das jeweils andere:
„Die Häuser und die Menschen glichen einander. Wind, Regen, Wald und Meer hatten alle gleich behandelt. Häuser wie Menschen waren gut gewässert, aber auch im Sonnenschein getränkt.“
„Das Rauschen des Meeres versuchte das Schnurren seiner Säge zu übertönen.“
„Das Knirschen des Kanus auf den Kieseln warnte die Stille, dass wir kommen und sie brechen würden.“
Ilga Eger „Ein Jahr im Garten“ (D, 2007)
Schon immer faszinieren mich Bücher, denen es mit den ersten Sätzen, den ersten zwei, drei Seiten, gelingt eine Stimmung so mit Worten lebendig werden zu lassen, dass ich nicht nur diese Worte lese, sondern selbst mitten in der geschilderten Szene bin. Solch ein Buch ist Ilga Egers „Ein Jahr im Garten“. Wer nach den ersten Seiten nicht einfach Sehnsucht danach hat, Ilgas Oma und deren Garten kennenzulernen, dem ist nicht mehr zu helfen.
Ilga Eger zeigt, dass Nature Writing vor Allem eine Perspektive auf die Natur um uns herum ist. Es muss nicht zwingend die berühmte „unberührte“ Natur sein. Auch das was wir heute als Wald oder „die Natur“ erleben ist in den meisten Fällen vom Menschen geprägt. Der Unterschied zwischen dem normalen ( = bewirtschafteten) Wald und einem strukturiert angelegten Garten ist gar nicht so groß.

Es ist eine ganz andere Art, der Natur zu begegnen und über sie zu schreiben. Ilga Eger ist eine, die mit der Natur in die direkte Zusammenarbeit geht. Da ist nicht nur das Betrachten, Wahrnehmen und Philosophieren, sondern das Handeln als Thema, das sie von den anderen unterscheidet. Das, was John Lewis-Stempel über sein Jahr im Wald erzählt, schreibt Ilga Eger über ihr Jahr im Garten. Der eine mit historischen Anekdoten und wissenschaftlichen Fakten, die andere mit dem Gemüsewissen der Großeltern und eigener Erdung.